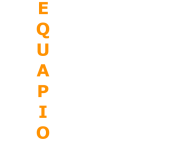Big Tech bändigen – das ist keine Lifestyle-Parole, sondern eine demokratische Notwendigkeit. Wer in Deutschland heute online kommuniziert, einkauft, Nachrichten liest oder navigiert, tut das über privat betriebene Infrastrukturen, die unsere öffentlichen Regeln weit hinter sich gelassen haben. Nicht das Verhalten einzelner Nutzer ist das Problem, sondern die schiere Systemrelevanz weniger Plattformen, deren Geschäftsmodelle unsere Aufmerksamkeit ausbeuten, unsere Daten extrahieren und anschließend KI-Dienste an Staat und Wirtschaft verkaufen. Wenn Demokratie handlungsfähig bleiben will, muss sie Big Tech bändigen – politisch, institutionell und mit eigenen, gemeinwohlorientierten Alternativen.
Big Tech bändigen: Vom Komfort zur Abhängigkeit
Bequemlichkeit war der Türöffner. Kostenlose Karten, Mail, Messenger und Clouds schufen ein Gefühl grenzenloser Verfügbarkeit. Daraus wurde Abhängigkeit: Daten, die wir in alltäglichen Diensten erzeugen, landen in Trainingspools für KI, die längst in sicherheitsrelevanten, medizinischen oder verkehrsplanerischen Bereichen mitverdient. Die Plattformen kassieren doppelt – erst bei der Datenerhebung, dann beim Verkauf „smarter“ Lösungen. Das ist keine neutrale Technikentwicklung, sondern eine Verschiebung politischer Macht hin zu Firmen, die demokratischer Kontrolle entzogen bleiben. Wer hier nur auf individuelles „Detox“ setzt, verkennt die Dimension. Es braucht Regeln für Infrastrukturen, nicht Tipps für Konsumverzicht.
Das Geschäftsmodell hinter der Fassade
Personalisierte Werbung wirkt wie das Zentrum der Plattformökonomie. In Wahrheit ist sie nur die sichtbare Oberfläche. Darunter arbeitet ein gewaltiger Apparat, der Klickströme, Bewegungsdaten, Bilder und Texte zusammenführt, um Modelle zu trainieren, die sich später teuer als Cloud-, Daten- oder KI-Leistungen verkaufen lassen. Captchas, Like-Buttons, Standortfreigaben – all das sind kleine Zahnräder in einem System, das aus öffentlichem Alltag privatwirtschaftliche Vorleistung macht. Wenn anschließend Verwaltungen, Kliniken oder Verkehrsbetriebe für den Zugang zu diesen Werkzeugen zahlen, finanzieren Bürgerinnen und Bürger indirekt die Monopole, die vorher aus ihren Handlungen entstanden sind. So entsteht ein Kreislauf der Privatisierung: öffentlicher Input, privater Output, öffentlicher Rückkauf.
Zwischen Regulierung und Realität: Wo EU-Recht heute nicht reicht
Europa hat mit Datenschutz- und Plattformgesetzen wichtige Leitplanken gesetzt. Doch rechtliche Transparenzpflichten allein verändern kein Markt-Design, das auf Lock-in, Netzwerkeffekten und Datenasymmetrien beruht. Interoperabilität bleibt lückenhaft, Datenportabilität ist zäh, Werbesysteme finden neue Umgehungen, und Aufsicht braucht Ressourcen, um durchzusetzen, was auf Papier steht. Je stärker sich zentrale Lebensbereiche – Gesundheit, Bildung, Mobilität – an private Clouds anlehnen, desto schwerer fällt spätere Korrektur. Regulierung, die nur kontrolliert, ohne eigene Alternativen aufzubauen, stabilisiert am Ende die Marktführer.
Big Tech bändigen mit öffentlichen Alternativen
Staatlich heißt nicht schwerfällig. Öffentliche und gemeinnützige Infrastrukturen können dort ansetzen, wo Märkte versagen: kuratierte Wissensräume statt Engagement-Fallen; offene Schnittstellen statt geschlossener Ökosysteme; Daten-Gemeingüter, die Stadtwerke, Schulen und Forschung gemeinsam nutzen – datensparsam, sicher, auditierbar. Bibliotheken, Rundfunk, Archive und Hochschulen sind bereits die natürlichen Orte für digitale Grundversorgung. Werden sie mit Mandat, Budget und Technik ausgestattet, können sie Such-, Lern- und Beteiligungsangebote bereitstellen, die nicht von Werbe-KPIs gesteuert sind. Big Tech bändigen heißt auch: eine Alternative finanzieren, die nicht beim nächsten Konjunkturzyklus verschwindet.
Kommunale Daten statt Datensilos
Der Alltag erzeugt Datenspuren – in Bussen, Netzen, Messstellen. Heute liegen sie zersplittert in privaten Silos. Städte könnten „Daten als Gemeingut“ organisieren: klare Zwecke, strikte Governance, unabhängige Audits, strenge Zugriffshierarchien und Bürgerbeteiligung. So ließen sich Fahrpläne dynamischer planen, Energie sparen, Flächen klüger nutzen – ohne Personenprofile, ohne Werbemarkt. Entscheidend ist die Architektur: Datenschutz by Design, differenzierte Anonymisierung, föderierte Auswertung, offene Standards. Demokratie gewinnt, wenn Planung auf nachvollziehbaren Daten statt auf Dashboard-Marketing beruht.
Gegen den Solutionismus: Probleme politisch lösen, nicht nur technisch
Eine App kann Schlaf messen, aber keine Nachtschicht abschaffen. Ein Tracker zählt Schritte, beseitigt aber keine Ernährungsarmut. Wer jedes soziale Problem in eine Sensorik-Aufgabe verwandelt, erzeugt Dauerüberwachung statt struktureller Lösungen. Demokratische Politik muss Ursachen adressieren: Lebensmittelpolitik statt Kalorienzähler, Arbeits- und Mietrecht statt Ratings, Verkehrsplanung statt Navigationsgamification. Technik soll unterstützen – nicht Politik ersetzen. Big Tech bändigen bedeutet, das Primat der Politik über die Logik der Plattformen wiederherzustellen.
Marktmacht begrenzen, ohne Fragmentierung zu belohnen
Zerschlagung klingt entschlossen, kann aber Netzwerkeffekte verstärken, wenn am Ende viele kleine, inkompatible Inseln entstehen. Wirkungsstärker sind Interoperabilitätspflichten, offene Protokolle und standardisierte Identitäten, die Wechselkosten senken und Wettbewerb auf der Ebene der Dienste statt der Umzäunung erzeugen. Ergänzend braucht es Fusionskontrolle, die Datenzugriffe bewertet, Werbemärkte transparent macht und Selbstpräferenzierung sanktioniert. So entsteht Vielfalt innerhalb eines gemeinsamen Netzes – und Nutzerinnen und Nutzer behalten echte Wahlfreiheit.
Deutschland kann vorangehen
Deutschland hat das institutionelle Gewicht, um Standards zu prägen: eine Beschaffung, die offene Schnittstellen bevorzugt; ein Förderrecht, das Gemeinwohl-Infrastruktur belohnt; eine Aufsicht, die Risiko dort bemisst, wo Abhängigkeit entsteht. Öffentliche Stellen sollten bei Kommunikations-, Lern- und Beteiligungswerkzeugen Vorbild sein: interoperable Messenger statt Insellösungen, offene Lernplattformen statt Datenhandel, kuratierte Recherche-Portale statt Clickbait-Feeds. Wenn Verwaltung, Bildung und Kultur sichtbar zeigen, dass es anders geht, entsteht Nachfrage jenseits der großen Plattformen.
Bürgerrolle erweitern: von Konsumenten zu Mitgestaltenden
Demokratie schrumpft, wenn sie sich in Kaufentscheidungen erschöpft. Nötig sind Foren, in denen Menschen über digitale Gemeingüter mitentscheiden – lokal, nachvollziehbar, mit echter Wirkung. Beteiligung ohne Datenabfluss, Streit ohne Shitstorm-Design, Moderation ohne Empörungsanreiz: Das ist kein Luxus, sondern Grundausstattung einer digitalen Öffentlichkeit. Big Tech bändigen gelingt, wenn Bürgerinnen und Bürger nicht nur Zielgruppen sind, sondern Autorinnen und Autoren der Regeln, nach denen ihre digitale Stadt funktioniert.
Schluss: Handlungsfähigkeit ist eine Architekturfrage
Deutschland muss Big Tech bändigen, weil Demokratie sonst an privatwirtschaftlichen Betriebssystemen hängt. Gesetze sind nötig, doch sie wirken erst, wenn öffentliche Alternativen existieren, die man wählen kann. Das heißt: Interoperabilität erzwingen, Daten-Gemeingüter bauen, öffentliche Kuratierung stärken, Beschaffung an Offenheit knüpfen und kommunale Innovation politisch absichern. Nicht jeder Klick ist politisch – aber die Infrastruktur dahinter immer. Wer sie gestaltet, gestaltet Freiheit.